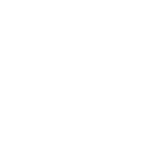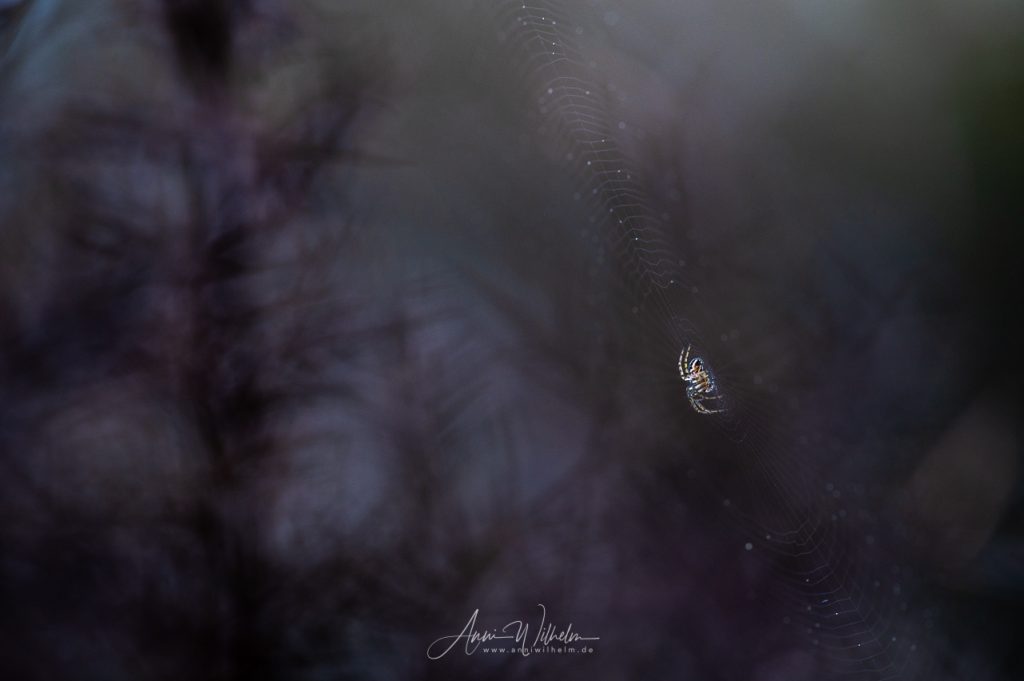Vor ein paar Tagen kam ich von meinem Urlaub zurück. Im Gepäck jede Menge wundervolle Eindrücke, Erlebnisse und Speicherkarten voll mit Fotos. Wenn man es genau nimmt waren es zwei Urlaube in drei Wochen, die nicht unterschiedlicher hätten sein können – wie Tag und Nacht.
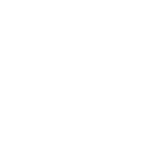

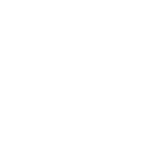
In den ersten beiden Wochen reiste ich mit einer Gruppe Paddelbegeisterter nach Albanien, um die Flüsse, von denen die Kajakszene so schwärmt, kennen zu lernen. Gestartet bin ich mit vielen Unbekannten, die sich innerhalb kürzester Zeit zu einer tollen Gemeinschaft entwickelt haben. Sowas habe ich bisher selten erlebt. Dementsprechend konnte ich die Erlebnisse auf dem Bach, ohne Spannungen, einfach nur genießen.
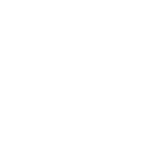
Angefangen mit der Cijevna noch auf montenegrischer Seite mit wundervoll glasklarem Wasser. Der Fluss fließt auf albanischer Seite unter dem Namen Cemi weiter. Es bahnte sich ein Highlight nach dem anderen an, mit Kir, Dushit, Valbona und zum krönenden Abschluss der Osum-Schlucht mit ihren gigantischen Felswänden und den Wasserfällen, an denen wir vorbeifuhren.
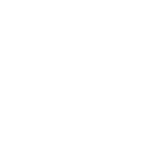
Außerdem bleibt noch zu erwähnen, dass die Valbona mit ihrem smaragdfarbenen Wasser der Soca ganz schön Konkurrenz macht. Nach diesen Eindrücken kann ich die Schwärmereien des ein oder anderen Kajakfahrers durchaus nachvollziehen. Die Flüsse und das Wildwasser, aber auch die Landschaften, sind wirklich unglaublich schön. Trotzdem kann ich nicht leugnen, dass die Müllproblematik noch nicht gelöst ist und die Straßenhunde, die auf den Müllbergen nach Nahrung suchen, die Stimmung etwas verdüstern. Wirft man jedoch einen Blick zurück, dann sah es in vielen südlichen Ländern vor Jahren ähnlich aus. Ich bin guter Dinge, dass es auch für Albanien in Zukunft Lösungen gibt und wir nicht mehr an jeder Ecke Berge von Plastik und sonstigem Schrott sehen werden.
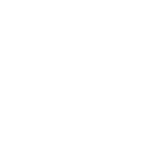


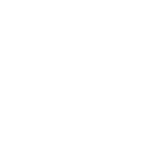
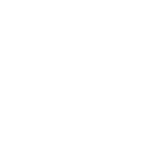
Für die letzte Woche bin ich dann von Albanien nach Portugal an die Algarve-Küste geflogen. Dort traf ich meine Freundin Andrea. Gemeinsam wollten wir die fantastische Felslandschaft ablichten – vorzugsweise bei Nacht. Mit dieser Art der Fotografie habe ich mich bisher noch nicht wirklich beschäftigt und ich habe mich sehr gefreut, dass Andrea mich hier unter ihre Fittiche genommen hat. Irgendwie ist es eine komplett andere Fotografie, als ich sie betreibe. Angefangen vom Scouten der Location bis hin zur detaillierten Planung: Wann haben wir eine klare Nacht? Ist es dunkel genug? Um wieviel Uhr ist die Milchstraße zu sehen und wie steht sie wo? Am Meer hatten wir dann auch noch das Problem mit Ebbe und Flut.
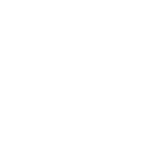
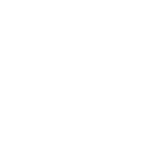
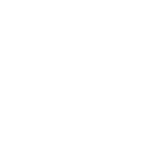
Für eine Location mussten wir durch ein Loch marschieren, was nur bei Ebbe möglich ist. Damit uns der Rückweg nicht abgeschnitten wird, mussten wir vor der Flut um 6 Uhr morgens so fertig sein. Da die Milchstraße aber erst um 4 Uhr dort ist, wo wir sie haben wollten, schied diese Location leider aus. Ohne Planung kann man demnach ganz schön alt aussehen. Außerdem ist es sinnvoll, sich schon tagsüber den Bildaufbau zu überlegen – Nachts sieht man nämlich so gut wie nichts. Mit dieser Vorbereitung waren die Fotos recht schnell im Kasten. Meine Herausforderung begann dann am Rechner. Wie ich erfuhr, gibt es für die Bearbeitung keine konkreten Regeln. Je nach Geschmack kann die Milchstraße dezent oder sehr stark hervorgehoben werden. Meine Bilder versuche ich meist wenig zu bearbeiten, damit der Betrachter das sieht, was ich durch die Kamera wahrgenommen habe. Bei Nachtaufnahmen ist es ein wenig anders, weil die Kamera viel mehr aufnimmt, als wir mit bloßem Auge sehen können. Daher habe ich versucht, diese Details herauszuarbeiten ohne zu übertreiben.
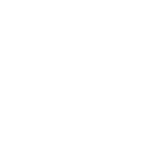
Wie ihr gerade erfahren habt, kann ich von Glück sprechen, dass mich die Fluggesellschaft mit dem Übergewicht an Eindrücken, Erlebnissen und Erfahrungen wieder nach Hause geflogen hat.